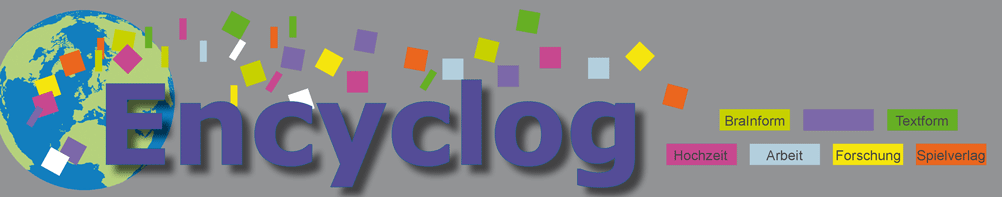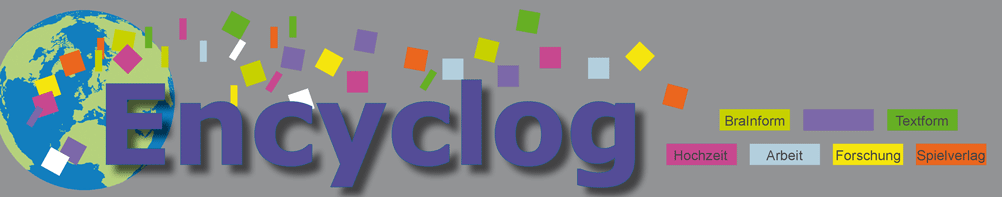Der Wiener Kreis und die Folgen
ACHTUNG: Logische Operatoren werden nicht korrekt dargestellt
1. Zur Vorgeschichte des Wiener Kreises
Positivismus: Eine (nicht eindeutig) bestimmbare Erscheinung der neuzeitlichen Philosophie, v.a. des 19. und 20. Jahrhunderts. Auguste Compte (1798-1854) gilt als eigentlicher Begründer. Entwicklung des Programms einer wissenschaftlichen Weltanschauung vor dem Hintergrund des Erfolges der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Drei-Phasen-Lehre: fiktiver (theologischer) Zustand, abstrakter (metaphysischer) Zustand, positiver (wissenschaftlicher) Zustand. Im Zentrum der Wissenschaft stehen Tatsachen und deren gesetzesmässiger Zusammenhang. Methode der Naturwissenschaft ist die Methode der Erkenntnisgewinnung (gegen Rationalismus). Nicht Wahrheit von Erkenntnis, sondern deren (intersubjektive) Gewissheit ist relevant. Wissenschaft soll nicht erklären, sondern beschreiben. Möglichkeit der intersubjektiven Nachprüfbarkeit ist zentral. Meist kein reiner Sensualismus, Theoriegeleitetheit der Erfahrung wird anerkannt. Existenz von synthetischen Urteilen apriori wird verneint. Metaphysikfeindlichkeit. Agnostizistische Tendenz. Wissenschaft potentiert menschliche Verfügungsgewalt über Natur (und das ist gut so). Weitere Vertreter der Positivismus: John Stuart Mill und Herbert Spencer.
Empiriokritizismus: (oder auch Immanenzpositivismus) Vertreten vor allem durch Avenarius und Ernst Mach. Zentral ist die „Analyse der Empfindungen“, die von metaphysischem Beiwerk abzutrennen ist. Nur Sinnesdaten gelten als real, d.h. radikal-subjektivistische Position. Prinzip der Denkökonomie: das Streben, die Gesamtheit des in der Erfahrung Gegebenen mit dem geringsten Kraftaufwand zu denken (Avenarius). Wissenschaft muss das unmittelbar Gegebene ökonomisch darstellen. Diese Position hat gewisse Probleme, z.B. ein Tisch unter verschiedener Perspektive wahrgenommen erscheint immer ander. Wie kommt man zum Tisch (das geht über das unmittelbar Gegebene hinaus)?
Logisch-mathematische Grundlagenforschung: Die Untersuchungen der Grundlagen der Logik und Mathematik gegen Ende des letzten und zu Beginn des jetzigen Jahrhunderts haben den Wiener Kreis entscheidend geprägt. Die Ausgestaltung der modernen Logik geht vor allem auf Gottlieb Frege, Boole und Schröder zurück. Das entscheidende Motiv ist die Vervollständigung der klassischen (aristotelischen) Logik. Grundprobleme der alten Logik: Nur sehr einfach beschaffene Ausdrücke (d.h. logische Atomsätze) können behandelt werden, jedoch keine komplexen logischen Urteile. Nur einstellige Prädikate sind erlaubt. All- und Existenzquantor können nicht gekoppelt vorkommen. Ein weiteres Motiv ist der Aufbau einer formalen Sprache voranzubringen. Schliesslich ist die Mathematik mit Antinomien konfrontiert, deren Lösung neue logische Techniken bedarf (z.B. Russels Antinomie der Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten).
Logizismus: Probleme der Mathematik der Jahrhundertwende (neben Antinomien): Unendlichkeitsproblem: Darf man die Existenz einer unendlichen Gesamtheit annehmen? Frege stellte sich dieser Frage. Er definierte dazu zuerst die Zahlen mittels Mengen. Danach führte er den Begriff des Nachfolgers und arithmetische Operationen auf die Logik zurück und schliesslich leitete er die Sätze der Arithmetik aus den Sätzen der formalen Logik ab. Damit schien das Problem einer Axiomatisierung der Arithmetik (welche sich mit unendlichen Mengen herumschlagen müsste) gelöst zu sein. Doch dann kam Russels Antinomie. Lösung von Russell/Whitehead: Typentheorie: Gegenstände und Mengen werden in eine Hierarchie von Stufen eingeteilt (zuunterst: Individuen. danach: Mengen von Individen, Mengen Elementen der zweiten Stufe usw. Doch auch hier ergeben sich Probleme.
Anderer Ansatz von Zermelo: Axiomatische Richtung der Mengenlehre. Mathematischer Intuitionismus (lehnt aktual-unendliches ab).
Andere Einteilung: Platonismus (mathematische Entitäten existieren und werden entdeckt), Formalismus (es gibt keine mathematischen Objekte, Mathematik ist ein von Menschen geschaffenes formales System), Konstruktivisten (nur das darf als Mathematik gelten, was in einer endlichen Konstruktion erreicht werden kann).
Andere Einteilung (Quine, On What There Is): Platonisten (abstrakte Entitäten der Mathematik existieren), Intuitionisten (abstrakte Entitäten der Mathematik sind vom Menschen erschaffen), Formalisten (keine mathematischen Universalien existieren, Mathematiker operieren aufgrund syntaktischer Regeln mit bedeutungslosen Zeichen).
Charles Sanders Peirce (1839-1914): Konzeption der Realität (Rezeption von Berkeley): Eschatologische Realitätsauffassung. Gemeinschaft der Forschenden ist die Instanz, welche Erkenntnis kreiert und prüft. Peirce versucht eine Art Vereinheitlichung der realistischen und idealistischen Position. Realität ist das Ziel der Erkenntnis. Dazu vier Methoden (Fixation of Belief): 1) Methode der Beharrlichkeit (man bleibt in eigenen Ansichten stecken, sozialer Charakter der Erkenntnis wird nicht anerkannt). 2) Methode der Autorität (vor allem in der Scholastik). 3) Methode des Apriori (macht Erkenntnis wieder zu einem subjektiven Unternehmen). 4) Methode der Wissenschaft (ausgehend von der Erfahrung. Gemeinschaft der Wissenschaftler wird zur Interpretationsgemeinschaft. Diese Methode muss man wählen). Ziel des methodischen Vorgehens ist eine Bändigung des Zweifels. Dazu eine Kritik am cartesianischen Zweifel (Einige Konsequenzen aus vier Unvermögen): 1) Wir haben kein Vermögen der Introspektion (gegen den universalen Zweifel). 2) Wir haben kein Vermögen der Intuition (individuelle Gewissheit ist unsinnige Bevorzugung des Subjekts). 3) Wir haben kein Vermögen, ohne Zeichen zu denken. 4) Wir haben kein Begriff vom absolut unerkennbaren (das können wir also in der Erkenntnis nicht anstreben). Was heisst Pragmatismus (How To Make Our Ideas Clear): Der Begriff von Etwas ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Wirkungen, und nicht mehr (pragmatische Maxime). Wichtig ist der evolutionäre Aspekt in seinem Denken.
Pierre Duhem (1861-1916): Einer der bedeutendsten Wissenschaftshistoriker der Jahrhundertwende. Er nahm als einer der ersten die Wissenschaft des Mittelalters ernst und beschrieb diese in ihrem historischen Kontext. Wandte sich gegen die damalige Vormacht der mechanischen Sichtweise der Physik und versuchte, diese in einer verallgemeinerten Thermodynamik neu zu entwickeln. Er gehörte damit zu den Wegbereitern der physikalischen Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Duhem ging von einem hypothetisch-deduktiven Theoriekonzept (Theorien sind „Entwürfe“, keine Induktion) aus und plädierte für einen gemässigten Konventionalismus. Die physikalische Theorie besteht primär aus einer effizienten Klassifikation von Tatsachen. Die dahinterliegende Theorie kann wechseln, während die Klassifikation meist gleich bleibt. Eine Theorie ist ein empirisch interpretierter, mathematischer Formalismus. Damit dokumentiert er ein Misstrauen gegenüber metaphysischem Beigemüse von wissenschaftlichen Theorien (Metaphysik im aristotelischen Sinn anerkennt er aber für den Alltagsgebrauch, vgl. mit seinem common-sense-Konzept). Er hatte ein instrumentalistisches Theoriekonzept, glaubte aber, dass die „naturgemässe Klassifikation“ Zielvorstellung der Wissenschaft ist.
Er nahm wesentliches der Entwicklung der modernen Wissenschaftstheorie vorweg: 1) Experimente brauchen Theorie über Messapparat und zu messenden Bereich, d.h. kein Experiment ohne Theorie. Es gibt keine theoriefreien Daten. 2) Duhem-Quine-These. Theorien werden als Ganzes bestätigt oder widerlegt. Revisionen der Grundgesetze sind zwar möglich, können durch das Experiment aber nicht erzwungen werden. Es gibt kein Experimentum Cruxis. Für Entscheidungen ist der wissenschaftliche „common sense“ zuständig (wissenschaftstheoretisch nicht ganz unproblematisch). Holistische Wissenschaftsauffassung. 3) Wissenschaftshistorischer Ansatz. Man muss die Wissenschaftsgeschichte mit den Augen von damals sehen. Doch den Aspekt der wissenschaftlichen Revolution übersah Duhem im wesentlichen, er betonte die Kontinuität des wissenschaftlichen Fortschritts. Duhems Thesen hatten grossen Einfluss auf den Wiener Kreis, aber auch auf Popper.
Ernst Mach (1838-1916): Begründer des Lehrstuhls, auf den schliesslich Moritz Schlick berufen wurde. Zusammen mit Avenarius Vertreter des Empiriokritizismus. Wandte sich damit gegen die Atomhypothese. Plädierte für eine scharfe Unterscheidung von Physik und Metaphysik (u.a. auch um der Kritik an der Wissenschaft um die Jahrhundertwende zu begegnen).
Bertrand Russell (1872-1970): Ist ebenfalls im Vorfeld des Wiener Kreises anzusiedeln. Insbesondere wegen den „Prinzipia Mathematica“ (zusammen mit Alfred North Whitehead, Logizistisches Programm, Ursprung mit Gottlob Frege (Begriffsschrift, später: Grundgesetze der Arithmetik, dazu mehr in Zusammenfassung zu Tarski), und auch Richard Dedekind) und dem logischen Atomismus. Atomare Sätze sind solche ohne logische Verknüpfungszeichen.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951): Verfasste mit dem „Tractatus logico-philosophicus“ gewissermassen die Bibel des Neopositivismus. Philosophie muss sich mit Sprache befassen. Bildtheorie motivierte erkenntnistheoretische Überlegungen des Wiener Kreises (zu Wittgenstein lässt sich noch viel mehr sagen. Wir erwähnen Wittgenstein in den folgenden Ausführungen).
2. Der Wiener Kreis
2.1. Das allgemeine Programm des logischen Empirismus
Grundsätzliches: Sprach- und Erkenntniskritik stehen im Zentrum. Skepsis gegenüber der Möglichkeit erfahrungsfreier Welterkenntnis. Positive Orientierung an den Naturwissenschaften. Sinnlosigkeitsvermutungen gegenüber Metaphysik, wobei diese in einem sehr weiten Sinn verstanden wird, d.h. Kritik an jeder Art von Philosophie, die behauptet, auf apriorischem Weg zu Wirklichkeitsbehauptungen oder zu normativen Aussagen gelangen zu können. Man kann den logischen Empirismus als Reaktion auf die Umwälzungen in den Naturwissenschaften und die Entwicklung der modernen Logik interpretieren, wobei primär die Frage gestellt wird, welche Auswirkungen diese auf die Philosophie haben. Insbesondere die Transzendentalphilosophie Kants geriet ins Wanken (Beispiele für synthetische Urteile apriori gehen aus. Unabhängig davon: Kants Analyse ist sicher die Klarste im Hinblick darauf, wie Metaphysik überhaupt möglich ist, d.h. gibt es synthetische Sätze apriori und worauf beruht deren Gültigkeit?). Nur zwei Arten von Erkenntnis werden anerkannt: analytische (Mathematik) und empirische (synthetische aposteriori) (Nur als Anmerkung: die alten Positivisten (Mill u.a.) sahen auch in der Mathematik eine empirische Verallgemeinerung. Quine nahm diesen Gedanken in anderer Form wieder auf). Auch die Tatsache, dass Philosophie offenbar kaum Fortschritte (im Sinn der Naturwissenschaften) macht, ist für den logischen Empirismus ein Problem. Man will das Fundament für ein kooperatives Unterfangen Philosophie legen (ähnlich wie Peirces Forschungsgemeischaft?). D.h. man braucht auch Kriterien dafür, was haltbar ist und was nicht.
Drei Grundinteressen: 1) Aufklärerisches Interesse an der Klarheit von Begriffen und Argumentationen, an Nachvollziehbarkeit und Intersubjektivität, an Transparenz des Redens und Denkens. 2) Drei Grundannahmen: Erkenntnis kann nur durch Erfahrung gewonnen werden. Es gibt Scheinsätze, die als solche gekennzeichnet werden müssen (Notwendigkeit eines Sinnkriteriums, Notwendigkeit auch der Unterscheidung zwischen Erleben und Erkennen). Die Logik ist ein unersetzliches Instrument für die Analyse und Rekonstruktion von Wissenschaft. 3) Daraus lassen sich einige Nachfolgeprobleme ableiten: Die Formulierung eines Sinnkriteriums ist mit einigen Problemen behaftet. Weiter ändert das Bild der Philosophie radikal (Reduktion auf Wissenschaftstheorie). Schliesslich werden eine Reihe von Reduktionsprogrammen angesprebt.
Zur Geschichte des Wiener Kreises: Das erste interdisziplinäre Projekt von fähigen modernen Naturwissenschaftlern, Mathematikern und Logikern mit philosophischer Bildung. Mitglieder: Moritz Schlick (seit 1922 auf Machs Lehrstuhl), Gustav Bergmann, Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Kurt Gödel, Bela von Juhos, Felix Kaufmann, Victor Kraft, Karl Menger, Olga Hahn-Neurath, Otto Neurath, Friedrich Waismann, Edgar Zilses. Gründung des Vereins Ernst Mach 1928. Kontakte zu Berlin: Hans Reichenbach, Philipp Frank, Richard von Mises. Weitere Personen im Umfeld: Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Karl-Gustav Hempel, Alfred Jules Ayer. Wissenschaftliche Weltauffassung war auch mit politischen, sprich sozialistischen Auffassungen verbunden. Auch sozialwissenschaftliche Fragen spielen eine Rolle. Aufkommen des Austrofaschismus zerstörte den Wiener Kreis. Schlick wird 1936 von einem irren Studenten ermordet. Der logische Positivismus wurde zu einer Emigrantenphilosophie und hatte entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der analytischen Philosophie in angelsächsischen Ländern.
2.2. Sinnkriterien
Rudolf Carnaps Überwindung der Metaphysik: Es geht um die Frage der Berechtigung von Metaphysik. Carnap: Es gibt zwei Arten von Scheinsätzen: Solche mit bedeutungsleeren Worten und solche, in welchen die Syntax der Sprache verletzt wird. Nun stellt sich die Frage: Was ist die Bedeutung eines Wortes? Diese untersucht man im Zusammenhang mit Elementarsätzen E, d.h. der einfachsten Satzform, wo das betreffende Wort vorkommt. Dabei stellen sich vier Fragen: 1) Aus was für Sätzen ist E ableitbar? 2) Unter welchen Bedingungen ist E wahr/falsch? 3) Wie verifiziert man E? 4) Welchen Sinn hat E? Alle Fragen bedeuten dasselbe in verschiedenen Kontexten. Wörter erhalten ihre Bedeutung durch Zurückführung auf Protokollsätze, wo die Wörter vorkommen (oder als Antwort zu den anderen Fragen: Wahrheitsbedingungen liegen fest, Weg zur Verifikation liegt fest, empirische Kennzeichen sind bekannt). Gelingt diese Zurückführung nicht, so hat das Wort keine Bedeutung, bzw. Sätze, wo das Wort vorkommt, sind Scheinsätze. Es gibt schliesslich auch Scheinsätze mit korrekter Syntax und Wörtern mit Bedeutung, wo aber ein Kategorienfehler auftritt (bei Carnap Verletzung der Typentheorie). (Cäsar ist eine Primzahl). Das Wort „sein“ verleitet zu Scheinsätzen. Metaphysik als inadäquater Ausdruck des Lebensgefühls.
Moritz Schlick zu Erkennen und Erleben: Trennung zwischen Begriff der Erkenntnis und Begriff des unmittelbaren Erlebens/Anschauens. Erkenntnis ist dreistellige Relation zwischen E-Objekt, E-Subjekt und E-Produkt (Schlick wirft die Nichtbeachtung dieses Unterschieds vor allem Husserl vor). Die erkenntnismässige Funktion von Begriffen besteht darin, dass sie eine eindeutige Zeichenfunktion (im Sinn von Typen) haben. Urteile sind eindeutig Tatsachen zuzuordnen (welcher Art ist diese Relation genau?). Schlick: Oberstes Ziel der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, mit einem Minimum an Begriffen zu einer eindeutigen Bezeichnung aller Tatbestände der Welt zu gelangen.
Grundproblem des Sinnkriteriums: Sprache lässt syntaktisch richtige Aussagen zu, die offensichtlich aber keinen Tatsachengehalt (bzw. kognitiven Gehalt) haben (abgesehen jetzt von emotionalem, poetischem usw. Gehalt). Mit welchem Kriterium kann man diese entsprechen klassifizieren? Erste Idee läuft etwa folgendermassen: Ein Satz ist kognitiv sinnvoll, wenn er in einer deduktionslogischen Beziehung zu einer Klasse von Beobachtungssätzen besteht. Die verschiedenen Abgrenzungsversuche unterscheiden sich von der Art der deduktionslogischen Relation. Ein falscher Elementareinwand vorweg: Man könnte sagen, deduktionslogische Beziehungen könnten sowieso nur zwischen sinnvollen Sätzen bestehen. sobald man also die Relation etabliert, wäre das Sinnvollsein der gegebenen Aussage schon vorweggenommen. Der Einwand stimmt insofern nicht, dass man das Kriterium nur auf die syntaktisch sinnvollen Sätze anwenden muss. Das syntaktisch Sinnvollsein genügt für die Etablierung einer deduktionslogischen Relation. Damit ist gleichzeitig gesagt, dass es Aussagen geben kann, auf welche alle logischen Operationen anwendbar sind, die sich aber trotzdem nicht als empirisch sinnvoll erweisen. Problem: Was ist ein Beobachtungssatz? Stegmüller: Ein Beobachtungssatz ist ein Satz, in dem behauptet wird, dass ein (oder mehrere) mittels Namen oder Individuenbeschreibung bezeichnetes Objekt ein beobachtbares Attribut hat.
Sinnkriterium, erste Version: Eine Aussage A ist genau dann empirisch sinnvoll, wenn sie nicht logisch determiniert ist und es eine konsistente endliche Klasse K von Beobachtungssätzen (wäre K nicht konsistent, so wäre das Vorderglied des Konditionals falsch und das Hinterglied könnte beliebig sein) gibt, so dass A eine logische Folgerung von K ist (Version von Schlick). Dazu drei Einwendungen: 1) Allsätze werden als sinnlos ausgeschaltet, denn man kann diese nicht aus einer eindlich grossen Klasse K ableiten. Naturgesetze haben aber die logische Form von Allsätzen und würden demnach kognitiv sinnlos, was nicht die Intention des Kriteriums sein kann. 2) Logisch komplexe Aussagen (z.B. ein sinnvoller Satz verkettet mit einem sinnlosen mittels Disjunktion) können sinnlose Atomsätze haben, die durch den Komplex sinnvoll werden. Dadurch werden Sätze erlaubt, die offensichtlich sinnlos sind. 3) Jede Wissenschaftssprache muss die unbeschränkte Anwendung logischer Operationen erlauben. Ist ein Existenzsatz sinnvoll, so muss auch dessen Negation sinnvoll sein. Diese ist aber mit einer Allaussage äquivalent und demnach wegen 1) sinnlos.
Moritz Schlick: Positivismus und Realismus
Was ist Positivismus?: Beginn mit einer Erklärung des Begriffs „Positivismus“ (1). Schlick will seine Position umreissen, ob man dem nachher noch „Positivismus“ sagt, ist unwesentlich. Positivismus leugnet die Möglichkeit von Metaphysik, unter Voraussetzung einer bestimmten Definition von Metaphysik. Diese umreisst er grob so, dass Metaphysik zwschen einer Welt der Erscheinungen und der Welt an sich unterscheidet und behauptet, Erkenntnisse über letztere gewinnen zu können (2). Der Positivismus geht vom „Gegebenen“ aus, ein nicht unproblematischer Term, wie Schlick, denn man könnte meinen, etwas sei da, das „gibt“ und das „nimmt“ (dreistellige Relation). Dies ist nicht der Fall. Für den Positivisten ist das gegebene nur das nicht hinterfragbare (3). Woran eskaliert der Unterscheid zwischen Positivist und Metaphysiker? Etwa im Streit um die Realität der Aussenwelt, d.h. verneint der Positivist diese (nur das Gegebene ist wirklich)? Das ist nicht der Fall. (die Gegenpositionen sind Realismus und Idealismus) Der Positivist hält die Problemstellung für sinnlos (4/5).
Der Sinn von Aussagen: Die Lösung des Sinnproblems vermag die Philosophie von Scheinproblemen zu befreien. Erste Version: der Sinn einer Frage wird deutlich, wenn man die Umstände angeben kann, unter welchen man sie mit ja bzw. nein beantworten kann (eine sinnvolle Aussage macht einen prüfbaren Unterschied, 8). der Sinn einer Behauptung besteht in der Angabe des verifizierenden Tatbestandes (6). Doch wie versteht man einen Satz überhaupt, bzw. die unmittelbare Bedeutung der Worte? Dies geschieht durch einen Akt des Zeigens (kann man alle Wörter zeigen?, wohl nicht). Der Sinn eines Satzes ist dasselbe wie die Angabe der Umstände (d.h. durch das Gegebene), unter welchen er wahr ist. Dies ist der Kerngedanke des Positivismus (7). Prüfbarkeit ist nur prinzipiell gemeint, d.h. sie muss logisch möglich sein (8). Wird beispielsweise in einem Satz die Wirkungslosigkeit eines Umstandes behauptet, ist der Satz sinnlos. Dieser Standpunkt vertrat die moderne Naturwissenschaft implizit schon immer (9) (Beispiel, Einsteins Analyse des Begriffs „Gleichzeitigkeit“, 10). Als Basis dienen Sinnesempfindungen, die eine besondere Unterklasse der Klasse des Gegebenen sind (10). Darüber sind sich die Physiker einig, sie streiten erst, wenn sie die Wissenschaft verlassen und in die Philosophie hinübergehen (Streit um die Realität der Aussenwelt). Problem der Sinnestäuschungen: Es braucht potentiell unendlich viele Verifikationen, das ist aber nicht möglich (und das gibt Probleme mit dem Sinnkriterium). Der Sinn liegt in einer endlosen Verkettung von Gegebenem (dadurch entgeht er den Psychologismus, wirklich?) (12). Es besteht auch eine Beziehung zwischen Verifizierbarkeit und Mitteilbarkeit. Mit dem Farbenbeispiel scheint er ein besseres Argument gegen den Psychologismusvorwurf zu liefern. Die innere Ordnung (die mitteilbar ist) von Empfindungen muss übereinstimmen, über die Empfindung selbt lässt sich nichts sagen (Behaviourismus) (13/14). Ein Satz über die Gleichheit von erlebnissen zweier Personen hat nur den Sinn einer gewissen Übereinstimmung der Reaktionen der beiden Personen (15). Nur das Mitteilbare einer Aussage entspricht deren Sinn (16).
Zur Realität der Aussenwelt: Ausgangspunkt: Analyse der Begriffe „es gibt“ und „Aussenwelt“. „Es gibt“ ist eine Existenzbehauptung. Existenz ist keine Eigenschaft (Kritik des ontologischen Gottesbeweises durch Kant!) (17). Für Schlick existiert die Aussenwelt und es wäre auch töricht, zu behaupten, die Dinge würden nicht „wirklich“ existieren (hat er dann aber nicht Probleme? Welchen Status hat dieser Satz?) (18/19). Trotzdem: Die Behauptung der Wirklichkeit eines Gefühls und der Wirklichkeit des Gegenstandes, der dieses Gefühl auslöst, ist vom Sinn her dieselbe. Jede Existenzaussage muss mit einer Eigenschaft verknüpft werden (d.h. (x)(Fx) statt nur (x), Kritik an Descartes) (20). Die Frage nach einer Realität hat nur dann Sinn, wenn man diese sinnvoll bezweifeln kann (d.h. bei Fragen nach der Realität von Einzelaspekten, nicht nach „der Realität“). Eine Wirklichkeitsaussage ist eine Einordnung in einen Wahrnehmungszusammenhang (21).
Zur Aussenwelt: Jedes Kind weiss, was Aussenwelt ist (und man kann auch nicht mehr wissen, Schlick unterscheidet zwischen der Aussenwelt des Alltags und der Aussenwelt des Metaphysikers, 25/26) (22). Problematische Aussage zur Existenz von Atomen, Elektronen u.a. (dahinter verbergen sich auch theoretische Aussagen) (23). Der transzendente und der empirische Wissenschaftler unterscheiden sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit nicht (24). Es gibt aber einen emotionalen Unterschied zwischen beiden Forschern (27). Man darf Erkennen und Erleben nicht verwechseln (25).
Zusammenfassung (29/30): Sinn eines Satzes ist seine Verifikation aufgrund des Gegebenen. Daraus folgt nicht, dass das gegebene wirklich ist (diese Behauptung ist sinnlos). Der konsequente Empirist leugnet die Existenz der Aussenwelt nicht (das wäre auch ein sinnloser Satz), d.h. Empirismus und Realismus sind keine Gegensätze. Gegenstand der Physik bilden Gesetze, nicht Empfindungen.
Sinnkriterium, zweite Version: Eine Aussage A ist empirisch sinnvoll genau dann, wenn sie nicht logisch determiniert ist und es eine konsistente endliche Klasse K von Beobachtungssätzen gibt, so dass die Negation von A eine logische Folgerung von K ist (Poppers Abgrenzungskriterium).
Dazu ebenfalls drei Einwände: 1) Das Kriterium scheidet universelle Existenzsätze aus den Wissenschaften aus, was ebenfalls nicht der Intention eines solchen Kriteriums entsprechen kann. 2) Analog zu oben wird eine Konjunktion einer sinnvollen und einer sinnlosen Aussage ebenfalls sinnvoll, da zu deren Falsifikation lediglich die Falsifikation eines Gliedes reicht. Auch hier kommt Metaphysik ins System. 3) Wieder analog zu oben: die Negation eines sinnvollen Allsatzes ist logisch äquivalent zu einem generellen Existenzsatz, der wegen 1) sinnlos sein muss. Eine Vereinigung beider Kriterien vermag das Problem ebenfalls nicht zu lösen (nur Einwand 3) fällt weg). Einwand 2) bleibt erhalten. Einwand 1) ebenfalls, sobald man die Verkettung von Allsätzen und generellen Existenzsätzen zulässt. solche finden sich in den Wissenschaften.
Sinnkriterium, dritte Version: Eine Aussage A ist emmpirisch sinnvoll genau dann, wenn es endlich viele weiteren Prämissen P1, ... Pm gibt, so dass mindestens eine Beobachtungsaussage B aus der Konjunktion von C und P1, ... Pm ableitbar ist, während B nicht allein aus P1, ... Pm gewonnen werden kann (Version von Ayers). Auch das klappt nicht. Beispiel: B ist „dieses Auto ist rostig“, A ist „Die Weltsubstanz ist blöd“. Man nimmt einfach die Prämisse (das verbietet niemand): P „Wenn die Weltsubstanz blöd ist, ist das Auto rostig“ und man kann A als sinnvoll klassieren.
Alfred Jules Ayer: The Elimination of Metaphysics
Seitenverweise beziehen sich auf deutsche Übersetzung
Kritik an Metaphysik: Ausgangslage: Die Metaphysik verspreche Erkenntnis über eine Realität, welche jene der Wissenschaft unf alltäglichen Erfahrung transzendiert. Die Ergebnisse der Metaphysik beruhen oft auf logischen Fehlern (41). Kann man die Metaphysik aber schon dadurch diskreditieren, dass ihre Voraussetzungen nicht empirisch sind? Nein, meint Ayers. Argumentation geht über die Behauptung der Sinnlosigkeit metaphysischer Aussagen (42). Schon Kant versuchte diesen Weg, aber bei ihm war die Unmöglichkeit der Erkenntnis des Dings an sich eine Tatsache und nicht ein Problem der Logik (42/43). Bei Ayer ist die Unmöglichkeit der Überschreitung der Grenze möglicher Sinneserfahrungen durch die Sprache gegeben, nicht durch die Beschaffenheit des menschlichen Bewusstseins (43).
Prinzip der Verifikation: Analog zur ersten Formulierung von Schlick: Ein sinnvoller Satz (Ayers spricht von Propositionen, d.h. von Intensionen des Satzes, was nicht ohne Probleme ist) ist ein im Prinzip verifizierbarer Satz (44). Dabei muss zwischen tatsächlicher und grundsätzlicher Verifizierbarkeit unterschieden werden (Mond-Beispiel, wie auch schon Schlick) (44/45). Mit der Unterscheidung zwischen starker und schwacher Verifizierbarkeit geht er aber über Schlick hinaus. Eine Proposition ist stark verifizierbar, wenn ihre Wahrheit durch Erfahrung schlüssig bewiesen werden kann (Schlick!). sie ist schwach verifizierbar, wenn ihre Wahrscheinlichkeit durch Erfahrung erwiesen werden kann (46). Der erste Fall hat Probleme mit Allaussagen (manche, z.B. Schlick, hält solche Aussagen dann eben für metaphysisch, d.h. für „wichtigen“ Unsinn) (46/47). Für Ayer sind Propositionen nichts anderes als (Wahrscheinlichkeits-)Hypothesen (47). Poppers Weg der Falsifikation geht auch nicht (47/48). Ayer argumentiert also für eine schwache Verifikation, d.h. es gilt die Frage zu beantworten, ob irgendwelche beobachtungen für die Verifikation einer Proposition relevant sein können oder nicht (48).
Explikation der schwachen Verifikation: Eine Proposition, die eine tatsächliche oder mögliche Beobachtung wiedergibt, heisst Erfahrungsproposition. Eine Satz heisst sinnvoll, wenn man aus ihm in Verbindung mit anderen Prämissen eine Erfahrungsproposition herleiten kann, die man aus den Prämissen allein nicht herleiten kann (das geht auch nicht, wie Church gezeigt hat, vgl. Stegmüller) (48).
Anwendung des Sinnkriteriums: Widerlegung (bzw. Sinnlosigkeitmachung) der Behauptung, die Welt der Sinneserfahrung sei unwirklich aufgrund des Arguments Sinnestäuschung (um solche zu erkennen, muss es wahre Sinneserfahrungen geben. Argument nicht vollständig. Sinnestäuschung motivieren Skeptizismus, gegen den muss er argumentieren) (49). Weiteres Beispiel: Streit um die Anzahl innerweltlicher Substanzen (Monisten, Dualisten Leibnitz u.s.w.). Die Frage nach der Substanz ist aber sinnlos (49/50). Weiteres Beispiel: Kontroverse zwischen Realisten und Idealisten (Beispiel Bild von Goya) (50/51). Apriori-Propositionen sind Tautologien. Es gibt demnach zwei Arten sinnvoller Sätze: empirische Hypothesen und Tautologien (52).
Wie entsteht Metaphysik?: Durch sprachliche Irrtümer (z.B. nicht gerechtfertigte Unterscheinung zwischen wahrnehmbaren Eigenschaften und wirklich seiendem und der Zuschreibung der Existenz an letzterem, nur weil man ein Wort dazu bilden kann) (53). Sehr problematischer Begriff ist „sein“, das in sehr verschiedener Bedeutung gebraucht werden kann (54/55). Weiteres Beispiel: Fiktive Entitäten. Eigenschaft des Fiktivseins behauptet nicht, dass das entsprechende Ding auch existiert! (54/55). Metaphysiker sind Dichter am falschen Platz (55). Doch das stimmt nicht, denn Dichter benutzen sinnlose Sätze als künstlerische Instrumente und behaupten nicht, sie seien sinnvoll (56/57).
Vorwort Ayers zur zweiten Auflage: Zuerst zur Verwendung von „Proposition“. Reaktion auf den einwand, sinnlose Sätze könnten keine Proposition ausdrücken, d.h. man müsste die Geltung des Sinnkriteriums voraussetzen, bevor man es anwendet (10). aber mit dem Begriff Proposition sind sowieso Schwierigkeiten verbunden, vor allem wenn man Intensionen ablehnt! Ayers Vorgschlag /vgl. auch Stegmüller): Wende das Kriterium nur auf Aussagen (statements), d.h. auf Sätze an, die den formalen Kriterien der Sprache genügen (Klasse der Propositionen wird eine Unterklasse der Klasse der Aussagen) (11-13). Weiter: Probleme mit dem Unterscheid strakte-schwache Verifikation (da gibt es offenbar keinen, wurde kritisiert). Ayers Antwort: Basispropositionen, die sich nur auf einen Erfahrungsinhalt beziehen, verwenden. Diese können als stark verifizierbar gelten (15-17). Ayers Revision im Sinne der folgenden vierten Version (19/20).
Sinnkriterium, vierte Version: Ayers hat sein Kriterium später verschärft, indem er die Zusatzforderung aufstellte, dass P1, ... Pm entweder analytisch sein müssen, oder dass es möglich sein muss, von ihnen unabhängig die Prüfbarkeit im Sinne des folgenden modifizerten, rekursiven Kriteriums aufzuzeigen: 1) A heisst direkt verifizierbar, wenn A entweder ein Beobachtungssatz ist oder wenn es endlich viele Beobachtungssätze gibt, so dass aus der Konjunktion von A und diesen Beobachtungssätzen ein Beobachtungssatz B’ deduziert werden kann, während B’ aus den anderen Beobachtungssätzen allein nicht deduziert werden kann. 2) A heisst indirekt verifizierbar, wenn es entweder endlich viele Prämissen gibt, so dass aus deren Konjunktion mit A mehrere Aussagen R abgeleitet werden können,. wobei alle R direkt verifizierbar sind und nicht aus den Prämissen allein abgeleitet werden können, oder wenn die Prämissen analytisch, direkt verifizierbar oder unabhängig indirekt verifizierbar sind. Also: Eine Aussage A ist genau dann empirisch sinnvoll, wenn sie nicht logisch determiniert, jedoch direkt oder indirekt verifizierbar ist.
Auch das klappt nicht. Beispiel: Seien drei voneinander logisch unabhängige Beobachtungssätze B1,B2 und B3 gegeben, sowie ein beliebiger, sinnloser Satz X. Betrachte dann die Aussage (B1 B2) (B3 X), genannt Q (da die Sachlage klar ist, verwenden wir die Unterscheidung Objektsprache-Metasprache nicht) . Es gilt: 1) Q ist direkt verifizierbar, denn aus Q und B1 ist B3 logisch ableitbar, jedoch B3 ist aus B1 nicht logisch ableitbar (Voraussetzung). 2) Aus X und Q folgt logisch B2. 3) Wenn nun B2 nicht logische Folgerung aus Q allein ist, so ist X indirekt verifizierbar (wegen Punkt 1 und 2). 4) Wenn aber B2 eine logische Folgerung aus Q allein ist, dann ist B2 auch eine logische Folgerung von B3 X. Denn wenn etwas aus p q logisch folgt, dann auch aus p oder q alleine. Dann ist also X direkt verifizierbar. All diese Überlegungen zeigen, dass sich ein deduktionslogisches Sinnkriterium nicht verwirklichen lässt.
Sinnkriterium, anderer Ansatz: Man kann den empiristischen Standpunkt auch anders, als mit deduktionslogischen Methoden, charakterisieren. Eine Möglichkeit ist, die syntaktischen Regeln des Sprachsystems derart zu gestalten, dass kognitiv sinnlose Sätze gar nicht erst entstehen können. Dieser Gedankengang macht auch den konventionellen Charakter eines jeden Sinnkriteriums deutlich. Eine derartige formale Sprache muss sich durch folgendes auszeichnen: Neben dem üblichen logischen Instrumentarium muss man verlangen, dass die Grundprädikate und Individuenkonstanten sich nur auf beobachtbares beziehen dürfen (offen bleibt dabei, ob man eine phänomenalistische oder eine physikalistische Sprache verwendet). Sinnlose Sätze würden demnach dadurch eliminiert, dass nichtempirische Prädikate gar nicht verwendet werden können und dass die Formregeln nur solche Kombinationen von ausdrücken gestatten, die nicht zu Sinnlosigkeiten führen. Doch ein solches System wäre immer noch nicht vollständig, denn eine Wissenschaftssprache muss auch die Möglichkeit erlauben, neue Prädikate einzuführen. Da lauern Probleme (Dispositionsprädikate!). Wird vorausgesetzt, dass ein unproblematisches Verfahren zur Einführung neuer Prädikate vorhanden ist (und damit eine rein empirische Wissenschaftssprache gegeben werden kann), lautet das Sinnkriterium dann: Eine Aussage A ist dann und nur dann sinnvoll, wenn es eine empirische Sprache S gibt, so dass A in einen Satz von S übersetzt werden kann.
Problem der theoretischen Terme: Es stellt sich nun die Frage, ob die oben geschilderte empirische Sprache für die Wissenschaft ausreicht. Problematisch sind vor allem theoretische Terme (wie die Schrödingersche -Funktion), bei welchen bestritten wird, dass sie sich auf Beobachtungsprädikate zurückführen lassen. Man muss alos auch theoretische Terme zulassen. Eine empirische Interpretation von Sätzen mit theoretischen Termen muss aber möglich bleiben.
Zum Status des Sinnkriteriums: Man muss sich fragen, was für eine Art Aussage das Sinnkriterium selbst ist. Gemäss Hempel lässt sich dieses als Explikation unserer Vorstellung eines sinnvollen Satzes verstehen. Das Sinnkriterium ist aber keine Behauptung, d.h. weder ein empirischer (in diesem Fall müsste man die für die Korrektheit des Kriteriums relevanten die Beobachtungen angeben können) noch ein analytischer (in diesem Fall wäre das Sinnkriterium eine Konvention) Satz. Man kann also die Sinnlosigkeit einer metaphysischen Aussage nicht „beweisen“.
2.3. Die Idee der Einheitswissenschaft
Reduktionsprogramm: Der logische Empirismus ist durch zwei Reduktionsprogramme gekennzeichnet: Ausgehend von den Arbeiten Freges, Russel/Whiteheads wurde der Logizismus vertreten, d.h. die Rückführung der Mathematik auf die Logik (und damit einhergehend die Idee eines Beweisalgorithmus, der alle wahren Sätze der Mathematik beweisen kann).
Physikalismus und Einheitswissenschaft: Gründe für das Projekt: Interdisziplinarität ermöglichen. Überprüfung von Naturgesetzen ermöglichen (Wahrnehmungsgegebenheiten mit abstraktem Begriffssystem verbinden). Zwei Anforderungen an Einheitssprache: Intersubjektivität, Universalität vor allem das zweite ist schwer zu begründen). Carnap glaubte, dass nur die Physik diese Anforderung erfüllte (damit ist gesagt, dass physikalische Prädikate die Grundprädikate der Wissenschaftssprache sein müssen, nicht aber, dass alle Gesetze sich auf physikalische Gesetze zurückführen lassen). Programm der Eiheitswissenschaft fordert u.a. eine behaviouristische Psychologie (da liegen Probleme verborgen v.a. die rein behavioristische Definition psychologischer Grundbegriffe scheint nicht zu funktionieren).
Der logische Aufbau der Welt: Carnaps 1928 erschienenes Werk gilt als ein Grundbuch des Wiener Kreises. Schon hier findet sich die strenge Unterscheidung zwischen Metaphysik und sonstigen philosophischen Bemühungen. Ein paradigmatisches Buch bezüglich Struktur und Verwendung der Logik. Das Buch entwirft ein „Konstitutionssystem“ (eine Art Stammbaum der Begriffe), das letztlich Auskunft geben soll, worüber eine Aussage gemacht werden kann. Alle wissenschaftlichen Aussagen sollen sich in Strukturaussagen umwandeln lassen, so Carnap. Problem: Welche Basis wählt man für das Konstitutionssystem (Wahl der Grundelemente und der Grundrelationen)? Carnap sieht drei Arten von Gegenständen: Physische, psychische und geistige. Gemäss Carnap ist sowohl das physische auf das psychische als auch das psychische auf das physische Rückführbar (eine sehr optimistische Einstellung). Weitere Unterscheidung: eigen-, fremdpsychisch. Nur ersteres ist einer Person unmittelbar gegeben, d.h. das Eigenpsychische soll als Fundament dienen (methodischer Solipsismus). Ein Begriff B konstituieren heisst: Eine allgemeine Regel (konstitutionale Definition) dafür aufstellen, wonach alle Aussagen, in denen B vorkommt, übersetzbar sind in Aussagen, wo Basisbegriffe (von B) vorkommen. Bei (mindestens) zwei Klassen von Begriffen ergeben sich aber Probleme: Dispositionsprädikate und theoretische Terme (dieses Problem hat er später durch die Unterscheidung von Beobachtungstermen und theoretischen Termen zu lösen versucht).
Dispositionsprädikate: Dispositionsprädikate bezeichnen Eigenschaften von Körpern, welche diese unter bestimmten Bedingungen annehmen (z.B. „löslich“, aber auch Temperatur u.a. metrische Grössen sind Dispositionsprädikate). Man kann Dispositionsprädikate in Sätze der Form „wenn ..., dann ...“ bringen und das Problem lautet dann, wie dieses wenn-dann zu interpretieren ist.
Folgende Varianten für die Definition eines Dispositionsprädikates wurden vorgeschlagen: 1) Interpretation als Konditional: z.B. x ist im Wasser: Wx, x löst sich auf: Lx, x ist löslich: Rx. Die Definition lautet: Rx =Def (t)(x)(Wx Lx). Das funktioniert nicht, denn dieses wird auch wahr, wenn das Vorderglied falsch ist (d.h. b gar nie in Wasser getaucht ist worden). 2) Man geht von Fällen aus, wo das Prädikat getestet wurde, und sucht Gegenstände, denen man infolge gleicher Eigenschaften auch dasselbe Dispositionsprädikat zuschreiben kann. Die Definition lautet dann: x ist löslich =Def Entweder ist x zum Zeitpunkt t im Wasser und es löst sich auf, ober x besitzt die Eigenschaft F, so dass alles, das diese Eigenschaft aufweist und zu einem Zeitpunkt t’ ins Wasser gegeben wird, sich bei t’ auflöst und es gibt bestimmte Dinge mit der Eigenschaft F, die sich auflösten, nachdem man sie ins Wasser gegeben hat (formalisiert man mit Prädikatenlogik 2. Stufe). Auch das klappt nicht. Sei Q eine Eigenschaft des unlöslichen Objektes O und betrachte F Q. O trifft auch auf diese Eigenschaft zu, welche aber mit obiger Definition vereinbar ist. 3) Eine dritte Möglichkeit wäre, ein irreales Konditional zu verwenden. Es gibt aber bisher offenbar keine akzeptable Bedeutungsanalyse von irrealten Konditionalen. 4) Carnap hat Reduktionen vorgeschlagen (vgl. Text): (t)(x) [Wxt (Rx Lxt)]. Diese Ausdrücke können aber nicht aus dem Kontext eliminiert werden, was bei einer gewöhnlichen Definition immer der Fall ist. 5) Man könnte schliesslich das Konditional so definieren, dass es bei einem falschen Vorderglied nicht definiert ist. Dann sind aber nicht mehr alle logischen Konstanten vollständig definierte Wahrheitsfunktionen.
Rudolf Carnap (1936): Über die Einheitssprache der Wissenschaft
Warum einheitliche Begriffe?: Logische Empiristen sind der Ansicht, dass Begriffe der verschiedenen Wissenschaften ein zusammenhängendes Gefüge bilden (60). Daraus gründet sich das Projekt einer Enzyklopädie (61). Kuh-Beispiel, d.h. Kuh-Begriff ist für Ökonom anders als für Biologe usw. (60/61). Bemerkung Neuraths: Ohne zusammenhängendes Begriffssystem wäre Alltagsbewältigung gar nicht möglich. Intensionale (Kuh-)Definition wird angestrebt, d.h. kennzeichnende Eigenschaften angeben. Spaltung der Wissenschaftssprache in logisch getrennte Begriffsgruppen ist ein Residuum traditioneller Philosophie (61/62).
Reduktion von Begriffen: Bisherige Methode zum Einführen neuer Begriffe: Definition. Einsetzbarkeit als notwendige Eigenschaft von Definitionen (Definiendum kann durch Definiens ersetzt werden) (62). Es gibt aber noch anderes Verfahren, neue Begriffe einzuführen: Reduktion. Warum das? Man kann nicht alle wissenschaftlichen Begriffe mittels Definitionen einführen. Gegenbeispiel: Dispositionsprädikate (genaue Diskussion siehe dort) (63/64) Lösung: Reduktionssatz. Problem: Durch Reduktion eingeführte Zeichen können nicht eliminiert werden (65).
Folgerungen: Unterschied zwischen Definierbarkeit und Reduzierbarkeit hat Folgen für die Formulierung der These des Positivismus bzw. Physikalismus (66). Früher: Jeder Begriff der Wissenschaft ist definierbar/rückführbar aufgrund von Begriffen der Sprache der Sinnesdaten / physikalischen Sprache. Zwischen Definierbarkeit und Rückführbarkeit wurde kein wesentlicher Unterschied gesehen. Jetzt muss man sehen, dass die beiden Formulierungen nicht gleichbedeutend sind. Vor allem die Übersetzbarkeitsthese ist falsch (66). Der logische Zusammenhang zwischen Sätzen der Wissenschaft und Sätzen der Sprache der Sinnesdaten / physikalischen Sprache ist komplizierter (66/67), Jetzt gilt einerseits: Begriffe der Wissenschaft sind reduzierbar auf Begriffe der Sinnesdatensprache. Andererseits: Jeder Satz der Wissenschaft ist übersetzbar in eine physikalistische Sprache. Eine physikalistische Sprache ist die durch reduktive Einführung neuer Zeichen erweiterter physikalische Sprache.
Begriffssystem der Enzyklopädie: Durch Einführung des Reduktionsbegriffs wird die Möglichkeit geschaffen, das Begriffsgebäude der Physik nur durch ganz wenige Begriffe zu fundieren (67). Bemerkungen zur Reduktion von Chemie (Biologie usw.) auf Physik, die nicht unproblematisch sind. Ideal ist immer, wenn Definitionen eingesetzt werden können (68). Schema der Zurückführbarkeitsbeziehungen. Man muss unterscheiden zwischen Beziehungen zwischen Begriffen, Beziehungen zwischen Sätzen und Beziehungen zwischen Gesetzen. Projekt der Enzyklopädie ist aber nicht utopisch, so Carnap (69/70).
Carnaps Überprüfbarkeit und Bedeutung (Testability and Meaning, 1936): Grundproblem der Verifikation/Falsifikation synthetischer Sätze: Man kann dies nur mehr oder weniger bestätigen. Neue Terminologie: Ein Satz heisst überprüfbar, wenn man eine entsprechend ausführbare Methode angeben kann, er heisst bestätigbar, wenn Umstände angegeben werden können, die den Grad seiner Bestätigung ändern. Ein Satz kann bestätigbar sein, ohne dass er überprüfbar wäre (d.h. wenn man die ausführbare Methode nicht kennt). Carnap will das Sinnkriterium mit den Begriffen „überprüfbar“ und „bestätigbar“ besser fassen. Er wendet das Kriterium auf ganze Sprachen an.
Weiter folgt eine Untersuchung des Problems der Dispositionsprädikate (vgl. oben). Carnaps Begriff der Reduktion: Er geht von folgendem Reduktionspaar aus: R1: P1 (P2 P3) und R2: P4 (P5 P3). P1 und P4 können als experimentelle Randbedingungen angesehen werden, unter welchen eine bestimmte Raum-Zeit-Stelle b die Eigenschaft P3 hat (bzw. ob P3 oder P3 zutrifft). P2 und P5 stehen für mögliche Resultate der Experimente. R1 bedeutet also: Unter Bedingung P1 und Ergebnis P2 hat die Raum-Zeit-Stelle b die Eigenschaft P3 (analog für R2). Dabei muss man den Fall ausschliessen, dass [(P1 P2) (P3 P4)] allgemeingültig ist, denn dann reduziert das Reduktionspaar das Prädikat P3 nicht. Aus weiteren Überlegungen (vgl. Text von Bornet, PS Peirce) schliesst Carnap, dass Reduzierbarkeit und Definierbarkeit unterschieden werden müssen. Dies hat Auswirkungen auf die These des Physikalismus. Früher: Jedes beschreibende Prädikat der Wissenschaftssprache ist auf der Grundlage der beobachtbaren Ding-Prädikate überprüfbar. Nach Carnaps Analyse: Jedes beschreibende Prädikat der Wissenschaftssprache ist auf der Grundlage der beobachtbaren Ding-Prädikate bestätigbar. Carnap kommt zu vier Forderungen an eine Sprache, welche dem Prinzip des Empirismus gehorchen soll: 1) Forderung der vollständigen Überprüfbarkeit. 2) Forderung der vollständigen Bestätigbarkeit. 3) Forderung der Überprüfbarkeit. 4) Forderung der Bestätigbarkeit. 1) und 2) können in Sprachen mit Quantoren nicht erfüllt werden. Carnap plädiert für die vierte Forderung.
2.4. Das Basisproblem: Protokollsätze und Wahrheitstheorie
Basisproblem allgemein: Was sind die letzten Überprüfungsinstanzen von empirischen Hypothesen? Schlick: Nur die eigene Konstatierung kann als Basis dienen. Das persönliche Erfüllungserlebnis findet in Beobachtungssätzen ihren Niederschlag. Diese sind zeitlich punktuell, d.h. die Sätze enthalten indexikalische Terme (Popper hat ihm Psychologismus vorgehalten). Neurath: Protokollsätze, abgefasst in einer intersubjektiv verständlichen Sprache, dienen als Fundierung. Popper: Theorien werden mittels Basissätzen (in der Gestalt singulärer Existenzsätze) falsifiziert. Zwei Aspekte des Basisproblems: Gibt es unbezweifelbare Basissätze? Gibt es überhaupt objektive Behauptungen oder sind diese nur Festsetzungen?
Otto Neuraths Protokollsätze: Eine aus sauberen Atomsätzen aufgebaute Idealsprache ist eine Fiktion. Hinweis auf Kohärenztheorie der Wahrheit (Schiffer-Zitat). Einheitswissenschaft besteht aus Tautologien und Realsätzen. Letztere zerfallen in Protokollsätze und Nicht-Protokollsätze (z.B. empirische gesetze). Beispiel eines Protokollsatzes: Ottos Protokoll 13.15 Uhr: [Ottos Sprechdenken war um 13.14 Uhr: (im Zimmer war um 13.13 Uhr ein von Otto wahrgenommener Tisch)]. Das Vorkommen eines Namens einer Person ist für Protokollsatz notwendig (bei Carnap ist dies nicht so, meth. Solipsist). Interessante Bemerkung zur Wandlung wissenschaftlicher Satzsysteme: Selbst Protokollsätze können ihre Intension ändern (vgl. zu Kuhn?).
Rudolf Carnaps Protokollsätze: Protokollsätze als Fundament des Physikalismus. Er sieht keinen Konflikt zu Neurath, vielmehr zwei verschiedene Methoden (kann er das, wenn Neurath Protokollsätze als wandelbar ansieht?): Protokollsätze ausserhalb bzw. innerhalb der Systemsprache. Im erste Fall müssen keine Anforderungen an die Form der Protokollierung gegeben werden, es ergibt sich aber das Problem, Übersetzungsregeln zu konstituieren (und das Problem ist grösser, als Carnap meint). Im zweiten Fall hat man es in einer einheitlichen Sprache zu tun und man braucht keine Übersetzungsregeln. Doch die Form der Protokollsätze muss vorgegeben werden (inwiefern ist das ein Problem?).
Rudolf Carnap (1936): Wahrheit und Bewährung
Seitenangaben gemäss Skirbekk
Wahrheit versus Bewährung: Beides muss unterschieden werden. Wahrheit ist zeitunabhängig, Bewährung ist zeitabhängig. Wahrheit galt wegen Antinomien als suspekt. Bewährung hingegen entspricht nicht dem allgemeinen Sprachgebrauch (Probleme mit dem Satz des ausgeschlossenen Dritten, denn bei den meisten wissenschaftlichen Sätzen ist weder der Satz noch dessen Negation bewährt). Dank Tarski ist Gebrauch von Wahrheit wieder unproblematisch. Die Definition von Wahrheit ergibt aber noch kein Kriterium für Bewährung (89). PS: Carnap verwechselt Definition und W-Konvention bei Tarski (90).
Bewährung: Um „Bewährung“ zu explizieren muss das Verfahren der wissenschaftlichen Nachprüfung beschrieben werden und die Bedingungen müssen angegeben werden, unter welchen der zu bewährende Satz als bewährt gilt. Sätze der Wissenschaft können nie endgültig verifiziert oder falsifiziert werden (90). Zwei Arten von Sätzen: direkt und indirekt nachprüfbare. Für direkt nachprüfbare Sätze sind Umstände denkbar, die starke Bewährung oder starke Erschütterung nahelegen (z.B. direkte Beobachtungssätze). Ein indirekt nachprüfbarer Satz steht mit direkt nachprüfbaren (sog. Kontrollsätzen) in einer bestimmten logischen Beziehung (z.B. aus Allsätzen Existenzsätze ableiten, die direkt nachprüfbar sind) (90/91).
Bewährung direkt nachprüfbarer Sätze: Zwei Varianten: 1) Konfrontation des Satzes mit der Beobachtung (diese liegen sprachlich in Protokollsätzen vor? oder wird so der Protokollsatz gebildet? das ist an dieser Stelle unklar!). Zur Versprachlichung der Beobachtung dient die Alltagssprache (Ausserdem spielt hier die Wahrheitsdefinition gemäss Tarski eine Rolle, d.h. die Teildefinition gilt: „x beobachtet y“ ist wahr, wenn x y beobachtet) (91/92). 2) Konfrontation des Satzes mit schon vorher anerkannten Sätzen. Der aufgrund 1) aufgestellte Satz gilt als bewährt, solange nicht bei der zweiten Operation Sätze gefunden werden, die schon vorher als bewährt galten, aber mit ihm unverträglich sind (kohärentistisches Moment). Der neue (oder einer oder mehrere der alten Sätze) muss dann verworfen werden (dafür kann man Regeln aufstellen, Carnap verweist dabei auf Popper). Operation 2) ist eine Hilfsoperation mit regulativer Funktion (92).
Zum Verhältnis Satz-Tatsache: In Punkt 1) ist das Problem des Verhältnisses der Tatsache und des Satzes, der diese Tatsache bezeichnet, verborgen. Carnap ist gegen das Wort „Vergleich“, denn man vergleicht Gegenstände und plädiert für die Verwendung von „konfrontieren“ (92/93). Damit ist nichts über eine (absolute) Realität der Aussenwelt gesagt, denn das Sprachsystem entscheidet mit, inwieweit sich ein Tatsachensatz bilden lässt (hier scheinen mir Probleme verborgen). Sein Beispiel: Nicht alle Sätze der klassischen Physik können in jene der modernen Physik übersetzt werden (93). Carnap kritisiert aber nur die Form des Satzes „der Satz wird mit der Tatsache verglichen“, nicht den Inhalt.
Zusammenfassung: 1) Man muss zwischen der Definition der Wahrheit und einem Kriterium der Bewährung unterscheiden. 2) Bei der direkten Bewährung sind zwei verschiedene Operationen vorzunehmen: Formulierung einer Beobachtung und Vergleich von Sätzen miteinander (94).
Carl G. Hempel (1935): Zur Wahrheitstheorie des logischen Positivismus
Seitenangaben gemäss Skirbekk
Hempels Absicht: Darstellung des Wandels der Wahrheitstheorie im logischen Empirismus: Von einer Korrespondenztheorie zu einer (eingeschränkten) Kohärenztheorie (96).
Ausgangslage Wittgenstein: Offensichtlich eine Korrespondenztheorie (im Tractatus). Es gibt atomare und molekulare Tatsachen, die atomaren und molekularen Aussagen entsprechen. Die logische Beziehung zwischen den Aussagen entsprechen den formalen Strukturen der Tatsachen. Die (Nicht-)Existenz einer Aussage hängt von der (Nicht-)Existenz der entsprechenden Aussage ab. Jede Aussage ist eine Wahrheitsfunktion der atomaren Aussagen, welche erstere bilden (96/97). Eine Aussage hat genau dann eine Bedeutung, wenn sie eine Wahrheitsfunktion der atomaren Propositionen ist (98). Diese Vorstellungen wurden vom Wiener Kreis weitgehend übernommen.
Abkehr von Wittgenstein, 1. Schritt: Neurath: Man kann nicht angeben, wie man einen Vergleich zwischen Sätzen und Tatsachen durchführen soll (Elementareinwand gegen jede Korrespondenztheorie). Carnap entwickelte aus den Ideen Neuraths ein erster kohärentistischer Entwurf einer Wahrheitstheorie: Elimination der Relation zu den Tatsachen. Eine bestimmte Klasse atomarer Aussagen wird als wahr ausgezeichnet, die Protokollsätze. Die Ersetzung der atomaren Aussagen durch Protokollsätze war der erste Schritt bei der Abkehr von Wittgensteins Wahrheitstheorie (97/98).
Abkehr von Wittgenstein, 2. Schritt: Damit geht eine Änderung der Auffassung über die formale Struktur des Systems wissenschaftlicher Aussagen einher. Allgemeine Aussagen sind dabei nicht mehr Wahrheitsfunktionen singulärer Aussagen (Unmöglichkeit der Verifikation/Falsifikation von Allaussagen), sondern haben den Charakter von Hypothesen, die sich bestätigen oder widerlegen lassen (98/99). Bei der Hypothesenwahl lässt man sich von methodologischen Kriterien wie Einfachheit leiten. Auch singuläre Aussagen haben den Charakter von Hypothesen (im Gegensatz zu Protokollsätzen) (99). Demnach kann man die Wahrheit oder Falschheit von Aussagen nicht unter Bezug auf die Wahrheit oder Falschheit bestimmter Basisaussagen definieren (99/100). Dies führt zu einer Lockerung bzw. Aufweichung des Wahrheitsbegriffs. In der Wissenschaft wird eine Aussage als wahr akzeptiert, wenn sie durch Protokollsätze ausreichen untermauert wird (100).
Abkehr von Wittgenstein, 3. Schritt: Problem: Was ist, wenn sich Protokollsätze widersprechen? Offenbar lässt man dann einen von beiden fallen und demnach sind auch Protokollsätze kein unbezweifelbares Fundament, d.h. es gibt keine absolut ersten Aussagen, auf die sich die Wissenschaft errichten liesse (100/101). Neurath bringt die Schiffer-Metapher, was eine Kohärenztheorie impliziert. Damit ist aber nicht die Abkehr vom empirischen gemeint (101). Dazu auf Carnaps Unterscheidung zwischen formaler und materieller Sprechweise. Im ersten Fall untersucht man die logischen Beziehungen zwischen als wahr anerkannten Protokollsätzen und den daraus abgeleiteten Konsequenzen. Im zweiten Fall geht es um die „Korrespondenz“ von Tatsache und entsprechender Aussage. Man (Schlick u.a.) wendete ein, dass mit der Abkehr von der Korrespondenz die sichere Basis für Wahrheit wegfällt. Einwand: In der Wissenschaft gibt es keine empirischen Sätze, die Sicherheit beanspruchen, d.h. die Suche nach einem absoluten Wahrheitskriterium ist nicht angemessen. Die materielle Sprechweise verführt zu Pseudoproblemen (102).
Einwand von Schlick: Schlick will eine absolut sichere Basis für Wahrheit. Sein Vorschlag: Konstatierungen („Hier jetzt so und so“). Doch Schlich muss zugeben, dass diese sicheren Konstatierungen nur Anlass sein können, (hypothetische) Protokollsätze aufzustellen (103). Schlicks Kritik an Carnap/Neurath: Es kann einander widersprechende Systeme von Protokollsätzen geben, welche dieselbe Hypothese stützen (Variante des Elementareinwands gegen die Kohärenztheorie) (104).
Übereinstimmung als empirisches Faktum: Carnap und Neurath antworten auf Schlick, dass es offenbar eine empirische Tatsache ist, dass die Gemeinschaft der Forscher im Laufe des Forschungsprozesses die „richtigen“ Protokollsätze finden (das Peircesche Bild) (104/105). Das Hervorbringen der wahren Protokollsätze geschieht wahrscheinlich durch Konditionierung (105).
Änderung des Protokollsatz-Status: Entwicklung des Wahrheitsbegriffs im logischen Empirismus hängt gemäss Hempel mit einem Auffassungswandel über den logischen Status von Protokollsätzen zusammen (105). Ursprünglich von Carnap gedacht als unwiderlegbares Fundament, erreichten sie schgliesslich einen Status, der sie von anderen Sätzen kaum mehr unterscheidet (105/106). Neurath will deshalb den ausdruck „Protokollsatz“ für Sätze verwenden, in welchen ein Beobachter und eine beobachtete Tatsache vorkommt. Carnap hält dem entgegen, dass die Festlegung der Form von Protokollsätzen in jedem Fall eine Konvention und keine Tatsachenfrage ist. Ausserdem müssen auch Beobachtungssätze selbst getestet werden (106). Begriff des Protokollsatzes jetzt wahrscheinlich überflüssig, so Hempel. Der konventionelle Charakter von Protokollsätzen entfernt den letzten absolutistischen Anschein vom logischen Empirismus (107).
3. Entwicklungen nach dem Wiener Kreis
3.1. Analytische Philosophie (nur ganz kurz)
Zwei Hauptströmungen: Die u.a. vom Wiener Kreis inspirierte Analytische Philosophie kennt zwei Hauptströmungen: Analyse der Alltagssprache und Aufbau und Untersuchung formaler Sprachen. Die erste Richtung geht davon aus, dass die Struktur der Sprache die Form der wirklichen Sachverhalte wiederspiegelt, während die zweite Richtung dies verneint und die Sprache als reine menschliche Kreation betrachtet. Die Spaltung findet auch darin Ausdruck, dass die erste Richtung Sprache primär als Medium der sozialen Interaktion betrachtet (z.B. Searle), während die formalsprachliche Richtung die Sprache als Instrument für die Formulierung wahrer Aussagen ansieht (Frege) (inwieweit widersprechen sich diese beiden Ansichten?). Grundsätzlich wird von beiden vorausgesetzt, dass ein direkter Zugang zur Sprache besteht (d.h. man kann die Funktionen von sprachlichen Ausdrücken objektiv erfassen), während dies bei der Aussenwelt nicht so ist.
3.2. Karl Poppers kritischer Rationalismus
Grundsätzliches: Drei Kritikpunkte am logischen Empirismus: 1) Probleme der Verifizierbarkeit (Sinnkriterien), denn die meisten naturwissenschaftlichen Sätze sind nicht verifizierbar. 2) Man kann nicht von einer induktiven Bestätigung von Theorien sprechen. Der Begriff der Hypothesenwahrscheinlichkeit lässt sich nicht definieren. 3) Deshalb kann das Überprüfungsverfahren naturwissenschaftlicher Hypothesen sich weder auf Verifizierbarkeit noch unter Verwendung von Induktion und Hypothesenwahrscheinlichkeit abstützen.
Karl Popper: Logik der Forschung (1934)
Vorwort: Grundproblem der Erkenntnistheorie: das Wachstum des Wissens, bzw. der Fortschritt der Wissenschaft. Dazu reicht das Studium der Wissenschaftssprache nicht (XV). Philosophische Ideen haben Bedeutung für Wachstum der Wissenschaft (XIX). Gegen Modellsprachen-Ansatz (zu wenig brauchbar) (XX). Hinweis auf realistische Konzeption: Annäherung an die Wahrheit ist möglich, sicheres Wissen ist aber unmöglich (XXV).
Grundprobleme der Erkenntnislogik: Induktionsproblem (d.h. Schluss von besonderen auf allgemeine Sätze) hat keine Lösung (3). Rechtfertigung von Induktionsschlüssen braucht Induktionsprinzip. Das gibt Probleme, denn dieses Prinzip kann nicht analytisch sein und auch nicht synthetisch (infiniter Regress) (4/5). Auch die Idee der Wahrscheinlichkeitsschlüsse geht nicht, sie führt ebenfalls zum unendlichen Regress oder Apriorismus (dazu mehr in seinem Kap. X). Man braucht deshalb eine deduktive Methodik der Nachprüfung (5). Psychologismus hat keinen Platz, dies u.a. wegen der Unterscheidung zwischen Entdeckungs- (hier ist der Platz der Psychologie) und Begründungszusammenhang (6). Vier Arten der deduktiven Überprüfung: Innere Widerspruchsfreiheit testen. Nicht-Tautologie testen. Bewertung des Fortschrittcharakters. Ableitung (und Prüfung) der Prognosen (7/8). Falsifikation der Prognosen trifft das ganze System. Bei missglückter Falsifikation spricht man von Bewährung (8). Weiteres Problem des Induktivismus: Man kann aus ihm kein Abgrenzungskriterium (von Metaphysik) herleiten. Versuche (des logischen Empirismus, Sinnkriterien) schlugen fehl (u.a. wegen Ausgrenzung von Naturgesetzen, 11) (9). Popper betrachtet das Finden eines Abgrenzungskriteriums als zentral. Er will Begriff „sinnlos“ wegen negativer Konnotation nicht verwenden (ausserdem hat Metaphysik grossen heuristischen Wert, 13) (10). Abgrenzungskriterium ist eine Festsetzung (12). Popper schlägt Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium vor, d.h. ein empirisch-wissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können (15). Dies funktioniert im Gegensatz zum Verifikationismus, weil zwischen Verifikation und Falsifikation eine Asymmetrie besteht (aber eben nur scheinbar, es gibt andere logische Formen, wo die Falsifikation ebenhalls nicht funktioniert) (15/16). Entgegnung der ad-hoc-Hypothese. Popper: Man muss Immunisierungsstrategien ausschliessen (als methodisches Prinzip) (16). Nun taucht das Basisproblem auf, v.a. die Beziehung der Basissätze (Aspekt der Logik) zu den Wahrnehmungserlebnissen (Aspekt der Psychologie) (17/18). Ein Wort zur wissenschaftlichen Objektivität: Deren Wesen ist die Intersubjektivität (18).
Problem der Methodenlehre: Für Popper ist die Erkenntnistheorie eine Methodenlehre. Die Bestimmung einer Methode ist immer eine Festsetzung (22). Eine empirische Wissenschaft ist durch ihre Methode gekennzeichnet (23). Ablehnung der naturalistischen Methodenlehre (d.h. Methodologie als empirische Wissenschaft, d.h. das tatsächliche Verfahren der Wissenschaft), denn diese verkennt das Element der Festsetzung und dogmatisiert diese dadurch (23-25). Beispiele von Festsetzungen: Wissenschaft hört nicht auf (d.h. kein absolutes Wissen kann erreicht werden). Bewährte Hypothesen nicht grundlos fallenlassen (26).
Theorien: Erkenntnislogik als Theorie der Theorien. Theorie ist ein System von Sätzen (31). Zur Fussnote: Popper plädiert für These der Theoriegeladenheit der Beobachtung. Poppers Erklärungsbegriff entspricht HO-Schema, d.h. Gesetze und Randbedingungen. Drei Arten von Begriffen: Allgemeine Sätze (Gesetze), besondere Sätze (Randbedingungen), Prognosen (31/32). Naturgesetze werden als Allsätze aufgefasst (gegen jene Wiener Kreisler, die gegen Allsätze sind, weil